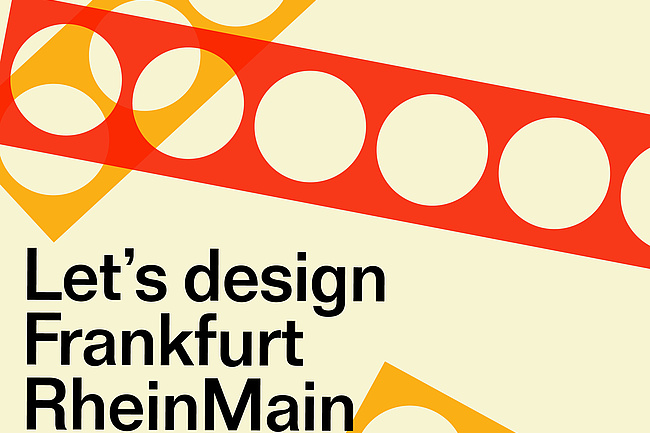Frankfurt ehrt Emilie und Oskar Schindler
Der Vorplatz des Frankfurter Hauptbahnhofs trägt seit Sonntag einen neuen Namen: In einer feierlichen Zeremonie wurde er in "Emilie-und-Oskar-Schindler-Platz" umbenannt. Oberbürgermeister Mike Josef (SPD), Ortsvorsteher Michael Weber und der Publizist Michel Friedman enthüllten am Nachmittag das neue Straßenschild. Am Abend folgte ein Empfang im Kaisersaal des Römers, bei dem Zeitzeugen und politische Vertreter die Verdienste des Ehepaars würdigten.
Die Umbenennung erfolgte am Vorabend des 118. Geburtstags von Oskar Schindler. Der Unternehmer und seine Frau Emilie hatten während des Holocausts mehr als 1200 Jüdinnen und Juden vor der Ermordung durch die Nationalsozialisten bewahrt. "Wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt", zitierte Oberbürgermeister Josef aus dem Talmud. Das Ehepaar Schindler habe "unter Einsatz des eigenen Lebens Menschlichkeit bewiesen, als dies lebensgefährlich war".
Die Entscheidung, den zentral gelegenen Platz in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs nach den Schindlers zu benennen, wurde bereits 2023 getroffen. Mit der Umsetzung soll nicht nur das Andenken an ihren Mut bewahrt, sondern auch der bislang wenig bekannte Bezug Oskar Schindlers zu Frankfurt sichtbar gemacht werden. Schindler lebte nach dem Zweiten Weltkrieg fast ein Jahrzehnt in der Mainmetropole, unweit des Bahnhofs.
Wegbereiter des Gedenkens
Ina Hartwig (SPD), Dezernentin für Kultur und Wissenschaft, erinnerte daran, dass Oskar Schindler durch Steven Spielbergs Verfilmung von Thomas Keneallys Roman Schindlers Liste weltbekannt geworden sei. Weniger bekannt sei jedoch die herausragende Rolle seiner Ehefrau Emilie. "Mit der Benennung des Platzes rücken wir auch Emilie Schindler stärker ins öffentliche Bewusstsein", so Hartwig.
Michael Weber, Vorsteher des Ortsbeirats 1, würdigte die Zivilcourage der Schindlers: "In einer Zeit, in der Wegschauen einfacher gewesen wäre, entschieden sie sich zum Handeln." Dies sei ein Vorbild für heutige und kommende Generationen.
Michel Friedman, dessen Eltern durch Oskar und Emilie Schindler gerettet wurden, fand eindringliche Worte: "Schindler bewies, dass die Hilflosigkeit vieler Deutscher im Angesicht des Nationalsozialismus eine billige Ausrede war." Angesichts aktueller Bedrohungen der Demokratie rief Friedman dazu auf, aus dem Beispiel der Schindlers Verantwortung abzuleiten: "Demokratie lebt vom Engagement jedes Einzelnen."
Zeitzeugenberichte
Zu den weiteren Rednern zählten die Historikerin und Biografin Erika Rosenberg-Band, die Emilie Schindler 1990 in Argentinien kennenlernte, sowie Michael Trautwein, Sohn eines Frankfurter Pfarrers und Freund der Familie Schindler. Rosenberg-Band erinnerte an die unerschütterliche Menschlichkeit Emilie Schindlers, die sich nie von Angst lähmen ließ: "Sie handelte aus Mitgefühl – mutig, selbstlos und ohne zu zögern."
Trautwein berichtete von seinen Kindheitserinnerungen an Oskar Schindler, den er als großzügigen und lebensfrohen Menschen kannte, dessen wahres Wirken er erst später begriff.
Ein Platz als Mahnung
Nach dem Krieg hatten Oskar und Emilie Schindler Deutschland zunächst verlassen und sich in Argentinien niedergelassen. Oskar Schindler kehrte 1957 nach Deutschland zurück und lebte bis zu seinem Tod 1974 wieder in Frankfurt. Beide wurden in Yad Vashem als "Gerechte unter den Völkern" geehrt. Emilie Schindler starb 2001 während eines Aufenthalts in Deutschland.
Mit der Benennung des "Emilie-und-Oskar-Schindler-Platzes" erhält die Geschichte eines außergewöhnlichen Ehepaares, das für Humanität und Zivilcourage einstand, einen festen Platz im öffentlichen Bewusstsein Frankfurts.